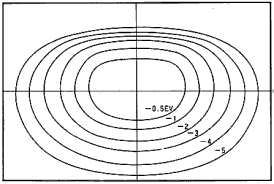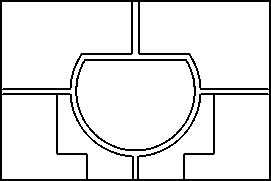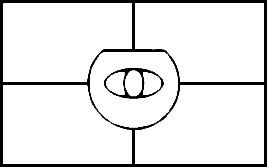| Technische Information - Meßsysteme |
|
''Sonne lacht, Blende 8'' oder ''Blende 4 im Zimmer stimmt immer'' - diese oder ähnliche Sprüche hat ja wohl jeder schon mal gehört. Gelten sie doch der Crux in der Fotografie, die passende Belichtung für das jeweilige Motiv zu ermitteln. Früher gab man sich schon damit zufrieden, eine annähernd kopierbare Schwärzung auf dem Film hervorzurufen, der Rest wurde bei der Ausarbeitung im Labor erledigt. Die frühen Fotografen verfügten meist über Belichtungstabellen, wenn sie nicht auf eigene Erfahrungswerte zurückgreifen konnten. Dort ließ sich nachschlagen, wie die richtige Belichtung in bestimmten Monaten, zur jeweiligen Tageszeit und bei gewissen Wolkenverhältnissen abzustimmen sei. Die ersten Belichtungsmesser arbeiteten nach dem fotochemischen Prinzip. Ein Papier wurde mit Silberchlorid bestrichen und in einem Rohr in Richtung des Objektivs gehalten. Die Zeit, innerhalb der das Papier sich grau verfärbte, sollte der annähernd korrekten Belichtung entsprechen. Eine recht zeitaufwendige und zudem nicht besonders exakte Methode. Bis in die Mitte unseres Jahrhunderts gab es optische Belichtungsmesser, bei denen man durch transparente Stufengraukeile schaute, auf denen Zahlen vermerkt waren. Die letzte lesbare Zahl ergab die ''korrekte'' Belichtungszeit. Alle diese Systeme hatten den großen Nachteil, daß sie auf der subjektiven Beurteilung des Fotografen beruhten. |
|
|
Bei der EM schwächte man die Mittenbetonung etwas ab, indem die Gewichtung auf 40:60% umgekehrt wurde: der 12 mm-Mattscheibenkreis wurde mit 40% und die Umgebung mit 60% bewertet. Dadurch kam man dem anvisierten Benutzerkreis der EM entgegen, der sich in den meisten Fällen wohl kaum Gedanken um das Anmessen der jeweils bildwichtigen Motivpartie gemacht haben dürfte. Bei der F3 wanderte die Meßzelle in den Boden des Spiegelkastens und wurde durch den in der Mitte teilperforierten Hauptspiegel mittels eines Hilfsspiegels mit Licht versorgt. Die Mittenbetonung wurde auf das Verhältnis 80:20% verstärkt, so daß man schon fast von einer Selektivmessung sprechen kann. Bei einer Selektivmessung wird nur eine bestimmte Fläche der Mattscheibe zur Belichtungsmessung herangezogen. Ab der F801 wird die mittenbetonte Messung mit 75:25% gewichtet. |
|
1983 kam der große Paukenschlag. Mit der AMP-Messung (Automatic Multi Pattern) der FA wurde zum ersten mal eine wirklich ''automatische'' Belichtungsmessung vorgestellt. Integral-, mittenbetonte, selektiv- oder Spot-Messungen arbeiteten in einem starren Meßschema. Je kleiner die Meßfläche ist, umso exakter kann man Motivdetails anmessen, aber umso geringer ist auch oft die Trefferquote. Bei der Mehrfeldmessung wird das Motiv in fünf fast gleich große Flächen zerlegt, die simultan/einzeln automatisch gemessen werden. Diese fünf Meßwerte werden in ein Belichtungsprogramm eingespeichert und die jeweilige Lichtsituation analysiert. Maßgebend dabei sind z.B. Motivkontrast, Lage extrem heller oder extrem dunkler Motivflächen oder Helligkeitswert extrem heller Motivteile, z.B. Sonne, Scheinwerfer oder Schnee. Mit diesen Informationen durchläuft die Messung ein Vergleichsraster, und der passende Belichtungswert wird zugeordnet. Dadurch steigt die Trefferquote auch bei extremen Lichtsituationen deutlich an. Diese Mehrfeld-Meßtechnik wird - leicht abgemagert auf drei Segmente - auch in der F401 eingesetzt. Bei den später folgenden Autofokus-Modellen wird sie, weiter optimiert, zur Standard-Meßmethode. Ab der F801 heißt sie jedoch nicht mehr AMP, sondern ''Matrix-Meßsystem'' und besitzt wieder fünf oder mehr Segmente. Die F4, Nikons Profimodell der Jahre 1988 bis 1996, erhält als erste Nikon eine Spotmessung, die einen ca. fünf Millimeter großen Kreis in der Suchermitte abdeckt. Als Schmankerl wird ihr außerdem ein Quecksilberschalter eingebaut, der die Matrix-Meßfelder bei Hochformataufnahmen umschaltet. In den folgenden Jahren werden alle neuen AF-Kameramodelle mit Matrix- und mittenbetonter Messung ausgestattet (je nach Modell etwas variiert), so daß den Fotografen stets mindestens zwei Meßmethoden zur Verfügung stehen. Die F801 und die Amateurmodelle F401, F401 s, F401x, F50 und F60 verfügen nicht über die Spotmessung. Die F801 S und die F601 erhalten sie als dritte Meßmethode, ebenso die Modelle für ''gehobene Amateur-'' oder professionelle Ansprüche: F70, F90, F90 X, F100 und F5. |
|
Die 1992 erschienene F90 läutet zudem das Zeitalter der 3-D-Matrixmessung ein: das Prinzip der Matrixmessung wurde beibehalten, aber um die dritte Dimension ergänzt. Dazu sind entsprechend ausgerüstete Nikkore erforderlich, die der Kameraelektronik mitteilen, auf welche Entfernung der Autofokus scharf gestellt hat. Diese Information geht dann in die Gewichtung der Belichtungsdaten mit ein. Das scharfgestellte Motiv erhält nun mehr Gewicht bei der Bestimmung von Zeit und Blende. Die meisten AF-Nikkore werden ab 1992 mit dem dazu erforderlichen ''D-Chip'' ausgestattet. Ihre neue Bezeichnung lautet folgerichtig ''AF-D-Nikkor''. Sollten Sie übrigens noch ältere AF-Nikkore ohne D-Chip besitzen, sollten Sie sie behalten: die 3-D- Belichtungsmessung mag Vorteile bieten, aber so groß, deshalb bereits vorhandene, ja meist hervorragende und nicht eben billige Nikon Objektive durch dieselben Optiken nur mit D-Chip zu ersetzen - so groß sind die Vorteile nicht. Die 3-D-Matrixmessung stellt eine sehr sinnvolle und intelligente Weiterentwicklung der Matrixmessung dar, aber keine Revolution. Hier die Kameras (Stand: Sommer 1999), die die 3-D- Matrixmessung bei Verwendung entsprechender AF-D- Nikkore unterstützen: F50, F60, F70, F90, F90 X, F100. Und die F5 nicht? Schon, aber das derzeitige Nikon Flaggschiff wartet mit einem eigenen Belichtungsmeßsystem auf, das die Präzision auf die Spitze treibt, der sogenannten 3-D-Color-Matrixmessung. Immer noch am Prinzip der AMP- beziehungsweise Matrixmessung orientiert, geht nunmehr nicht nur die Entfernung sondern auch die Farbe des Motivs in die Belichtungsmessung ein. |
| |
Fenster schließen |
| www.digitalb2.de/nikon/systemcd | |